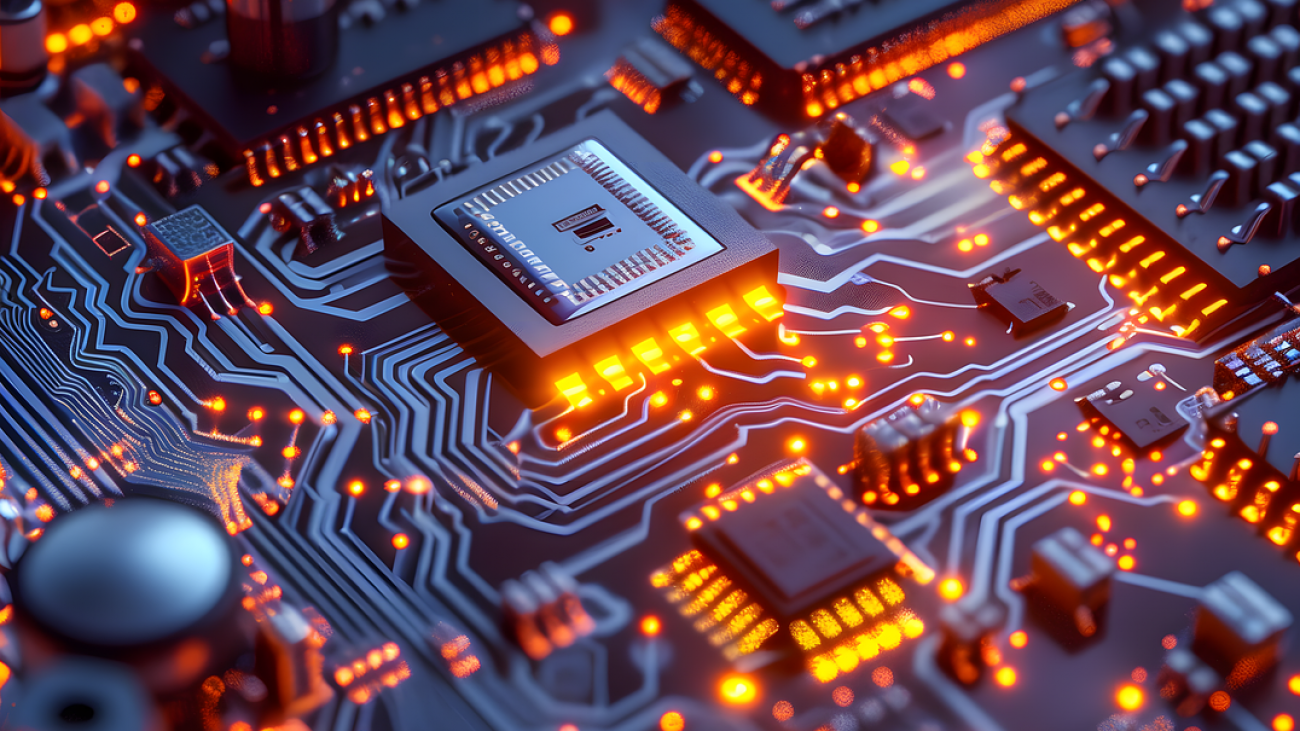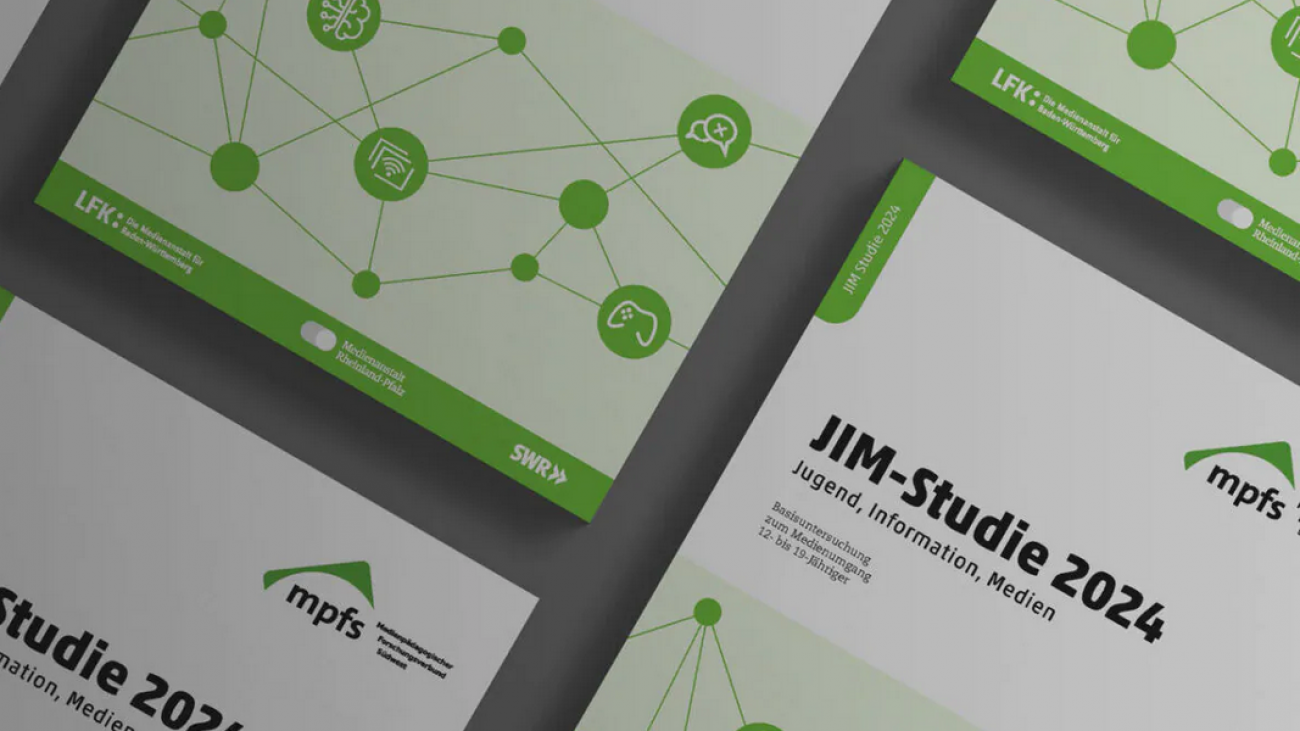Die in TIMSS 2023 („Trends in International Mathematics and Science Study“) getesteten Viertklässlerinnen und Viertklässler in Deutschland zeigen eine konstante Leistung in Mathematik und Naturwissenschaften im Vergleich zu 2019 trotz pandemiebedingter Einschränkungen im Schulbetrieb in den Jahren 2020 und 2021. Im internationalen Vergleich befindet sich Deutschland 2023 wie auch schon 2019 und 2015 im Mittelfeld des Gesamtrankings. Im Langzeittrend zu 2007 zeigen sich für Deutschland in Mathematik keine Kompetenzveränderungen, während in den Naturwissenschaften ein Rückgang festzustellen ist.
Nach wie vor besteht in beiden Fächern eine enge Kopplung zwischen dem sozioökonomischen Status der Familien und dem Bildungserfolg der Kinder. Dieser Befund ist seit 2007 stabil. Der Anteil an Schülerinnen und Schülern, die die Mindestanforderungen nicht erfüllen, ist in beiden Fächern sehr hoch. Hier zeigt sich in den Naturwissenschaften sogar eine leichte Verschlechterung.
Die heute veröffentlichte Studie TIMSS 2023, untersucht seit 2007 alle vier Jahre die mathematischen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern der 4. Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich.
Die wichtigsten Ergebnisse für Deutschland im Überblick
Für das Fach Mathematik:
- Die mittleren mathematischen Kompetenzen der Viertklässlerinnen und Viertklässler betragen 524 Punkte. Sie liegen damit signifikant über dem internationalen Mittelwert (503 Punkte) und sind identisch mit dem Mittelwert der 22 teilnehmenden EU-Staaten[1] (524 Punkte) sowie vergleichbar mit dem der 29 teilnehmenden OECD-Staaten (525 Punkte). Das Leistungsniveau ist im Vergleich zu TIMSS 2007 (525 Punkte) und TIMSS 2019 (521 Punkte) stabil.
- Die höchste Kompetenzstufe V erreichen 8,3 Prozent der Viertklässlerinnen und Viertklässler (international 10,4 Prozent; EU 9,5 Prozent; OECD 11,5). Dieser Anteil ist im Vergleich zu 2007 (5,6 Prozent) und 2019 (6,0 Prozent) signifikant gestiegen.
- Der Anteil der Schülerinnen und Schüler auf den niedrigsten Kompetenzstufen I und II liegt bei 25,1 Prozent (international 36,6 Prozent, EU: 26,4 Prozent, OECD: 27,1 Prozent). Während dieser Anteil im Vergleich zu 2019 (25,3 Prozent) stabil ist, ist für 2007 (21,6 Prozent) ein signifikanter Zuwachs zu verzeichnen, der auf einen Anstieg auf der untersten Kompetenzstufe zurückzuführen ist.
Für das Fach Naturwissenschaften:
- In den Naturwissenschaften liegen die mittleren Kompetenzen mit 515 Punkten signifikant über dem internationalen Mittelwert (494 Punkte) und sind vergleichbar mit dem der teilnehmenden EU-Staaten (518 Punkte). Die OECD-Staaten sind im Mittel signifikant besser (526 Punkte). Das Leistungsniveau ist im Vergleich zu TIMSS 2019 (518 Punkte) stabil; liegt aber, wie bereits 2019, signifikant unter dem Niveau von TIMSS 2007 (528 Punkte).
- Die höchste Kompetenzstufe erzielen 8,7 Prozent der Viertklässlerinnen und Viertklässler (international: 8,3 Prozent; EU: 7,9 Prozent; OECD: 10,2). Dieser Anteil unterscheidet sich nicht signifikant von 2007 (9,6 Prozent) und 2019 (6,9 Prozent).
- Über ein lediglich rudimentäres Kompetenzniveau verfügen 29,7 Prozent der Viertklässlerinnen und Viertklässler (international: 38,7 Prozent, EU: 27,9 Prozent, OECD: 25,4 Prozent). Während dieser Anteil im Vergleich zu 2019 (27,7 Prozent) stabil ist, ist gegenüber 2007 (23,7 Prozent) ein signifikanter Zuwachs zu verzeichnen.
Sonstige Ergebnisse:
- 58,0 Prozent der Viertklässlerinnen und Viertklässler haben eine positive Einstellung zur Mathematik, in den Naturwissenschaften sind dies 70,6 Prozent. Trotz rückläufiger Tendenz gegenüber 2019 (Mathematik: 64,9 Prozent; Naturwissenschaften: 74,1 Prozent) und 2007 (Mathematik 69,9 Prozent; Naturwissenschaften: 80,7 Prozent) ist der Anteil weiterhin hoch.
- 63,6 Prozent der Lehrkräfte für Mathematik berichten, dass ihnen digitale Medien im Unterricht zur Verfügung stehen (international: 48,2 Prozent; EU: 54,0 Prozent; OECD: 61,1 Prozent); für die Naturwissenschaften beträgt der Anteil 82,6 Prozent (international: 60,5 Prozent; EU: 66,6 Prozent; OECD: 73,7 Prozent). Trotz hoher Verfügbarkeit erfolgt der Einsatz von digitalen Medien im Fachunterricht bislang nur eingeschränkt.
- In Mathematik zeigen sich wie im Jahr 2007 und 2019 signifikante geschlechterspezifische Unterschiede zugunsten der Jungen. Für die Naturwissenschaften bestehen 2023 keine signifikanten Unterschiede mehr. Dies ist allerdings auf ein Absinken des Leistungsniveaus der Jungen zurückzuführen.
- Das Kompetenzniveau in Mathematik und in den Naturwissenschaften ist weiterhin eng an soziale und herkunftsspezifische Faktoren gekoppelt. Dabei ist seit 2011 der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Unterstützungsbedarfen gleich geblieben und der Anteil mit Migrationshintergrund seit 2007 gestiegen.
Die Studie „Trends in International Mathematics and Science Study“ (TIMSS) ist eine international vergleichende Schulleistungsuntersuchung, die unter der Koordination der International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) durchgeführt wird. In Deutschland wird die Studie durch ein wissenschaftliches Konsortium unter der Leitung von Prof. Dr. Knut Schwippert (Universität Hamburg) durchgeführt.
An TIMSS 2023 beteiligten sich weltweit insgesamt 58 Teilnehmerländer, darunter 22 EU-Mitgliedstaaten und 29 OECD-Staaten. Die repräsentative Stichprobe in Deutschland umfasst 4.442 Viertklässlerinnen und Viertklässler an 230 Schulen. Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an den Kompetenztests war in Deutschland verpflichtend. Zusätzlich erhielten die Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Schulleitungen und Erziehungsberechtigten Hintergrundfragebögen; der Verpflichtungsgrad variierte dabei je nach Bundesland.
Weitere Informationen
https://www.timss.uni-hamburg.de/
Weiterlesen und Quelle: https://www.kmk.org/presse/pressearchiv/mitteilung/grundschuelerinnen-und-schueler-halten-ihre-leistungen-in-mathematik-und-naturwissenschaften-und-da.html

 Cart is empty
Cart is empty