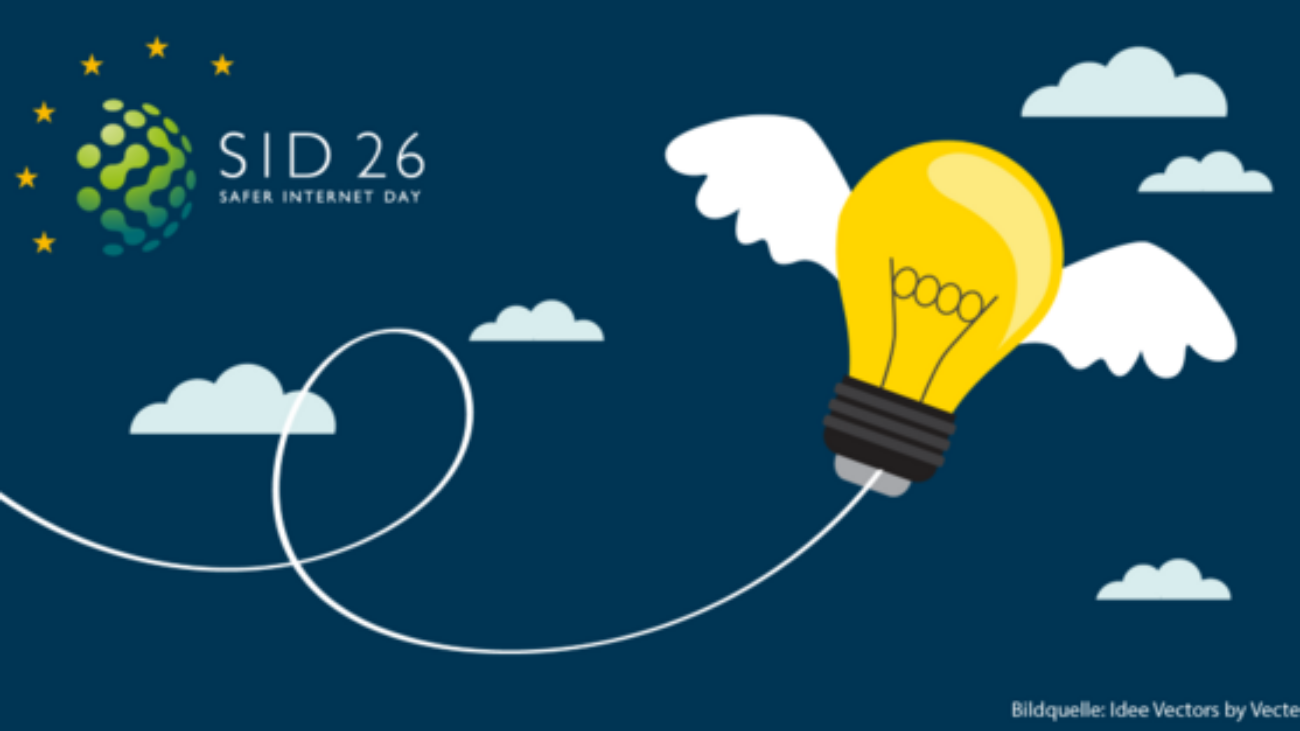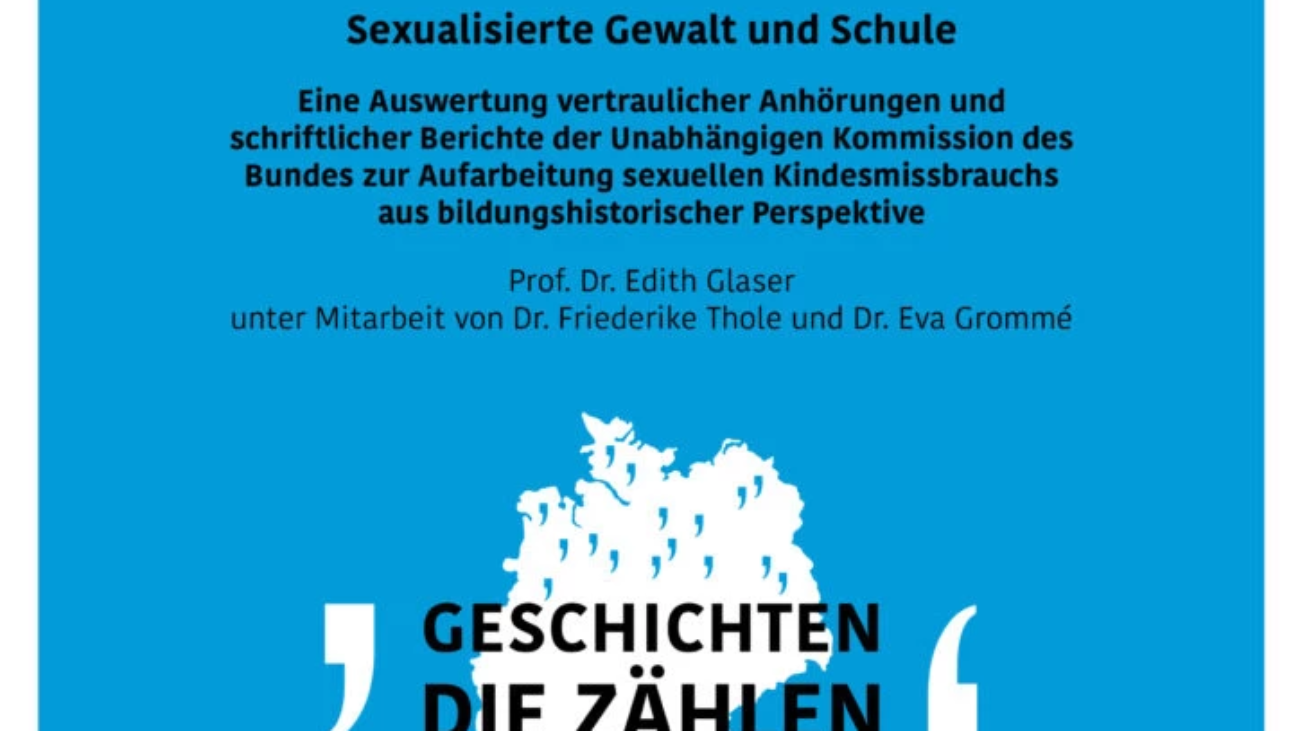Bundeskabinett beschließt Bericht über Ausbaustand der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder
Das Bundeskabinett hat den dritten Bericht der Bundesregierung über den Ausbaustand der ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder beschlossen. Am 1. August 2026 wird der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter jahrgangsweise in Kraft treten. Damit werden bis im Schuljahr 2029/30 Kinder der ersten bis zur vierten Jahrgangsstufe einen Anspruch auf ganztägige Bildung und Betreuung haben.
Der dritte Bericht der Bundesregierung über den Ausbaustand der ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder zeigt, dass die Mehrheit der Familien Ganztagsangebote in Anspruch nimmt: im Schuljahr 2023/24 besuchten rund 1,9 Millionen aller sechseinhalb- bis zehneinhalbjährigen Kinder in der Bevölkerung eine Ganztagsschule oder eine Tageseinrichtung (Hort). Das sind 57 Prozent (westdeutsche Länder 51 %, ostdeutsche Länder 84 %). Bis zum Schuljahr 2029/30 werden zusätzlich im deutschlandweiten Mittel etwa 264.000 Plätze benötigt. Der prognostizierte Ausbaubedarf hat sich im Vergleich zu den Vorjahren deutlich reduziert, u. a., da Länder und Kommunen mit Unterstützung des Bundes stetig neue Plätze geschaffen haben.
In der Prognose des Elternbedarfes wurde mit zwei Szenarien gearbeitet. Im Szenario eines konstant bleibenden Bedarfs werden im Schuljahr 2026/27 (2029/30) rund 166.000 (190.000) und im Szenario eines deutlich steigenden Bedarfs 284.000 (339.000) zusätzliche Plätze benötigt. Dabei fällt der überwiegende Teil des quantitativen Ausbaubedarfs auf die westdeutschen Flächenländer, während in den ostdeutschen Ländern vor allem ein qualitativer Ausbau stattfindet. Wird nur der zusätzliche Platzbedarf für die erste Klasse im Schuljahr 2026/27 betrachtet, für die der aufwachsende Rechtsanspruch zum 1. August 2026 zunächst gilt, werden bei konstantem Bedarf bis zu 30.000 und bei steigendem Bedarf bis zu 65.000 Plätze zusätzlich benötigt. Laut Bericht rechnen die Landesverantwortlichen damit, dass sie zu Beginn des Rechtsanspruchs im Schuljahr 2026/27 ein (eher) bedarfsdeckendes Angebot vorhalten können.
Die Bundesregierung stellt mit dem Beschleunigungsprogramm bis Ende 2022 sowie dem Investitionsprogramm Ganztagsausbau 2023-2029 rund 3,5 Milliarden Euro für Investitionen in den Ausbau der kommunalen Bildungsinfrastruktur zur Verfügung, um den notwendigen Platzausbau zu unterstützen. Den durch den Rechtsanspruch entstehenden zusätzlichen Betriebskosten der Länder trägt der Bund durch Änderung des Finanzausgleichsgesetzes Rechnung: Die vertikale Umsatzsteuerverteilung wird zugunsten der Länder ab 2026 jährlich aufwachsend von 135 Mio. € auf bis zu 1,3 Mrd. € pro Jahr ab 2030 angepasst.
Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag jährlich einen Bericht über den Ausbaustand der ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder vor (GaFöG-Bericht). Federführend ist das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, hier ist auch die Geschäftsstelle zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter angesiedelt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.bmbfsfj.bund.de/ganztag und www.recht-auf-ganztag.de
Weiterlesen und Quelle: https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/aktuelles/pressemitteilungen/vor-inkrafttreten-des-rechtsanspruchs-ganztagsausbau-geht-kontinuierlich-voran-276946

 Cart is empty
Cart is empty